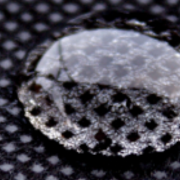95 Kaninchen und Benzin
Dieser Artikel stellt Innovationen für Biokraftstoffe vor, eine von 100 Innovationen im Rahmen von „The Blue Economy”. Dies ist Teil einer breit angelegten Bewegung für mehr Unternehmertum, Wettbewerb und Arbeitsplätze.
Der Weltmarkt für Biokraftstoffe
Der Weltmarkt für Biokraftstoffe wurde im Jahr 2011 mit 82,7 Milliarden US-Dollar bewertete und verdoppelt sich erwartungsgemäß bis 2021 auf 185,3 Milliarden Dollar. Bereits 2012 wird die weltweite Erzeugung von Biokraftstoffen 118 Milliarden Liter erreichen; bis 2015 werden es 155 Milliarden Liter sein. Der Markt ging 2006 mit 49 Milliarden Litern an den Start. Bis 2021 wächst die Produktion noch auf 250 Milliarden Liter an. So ergibt sich ein jährliches Wachstum von 15-20% und der Anteil am Treibstoffverbrauch steigt von 3 auf 8,5 Prozent an, was 40 Prozent des globalen Wachstums auf diesem Sektor entspricht. Schätzungen zufolge werden bis 2030 bis zu 30 Prozent der Treibstoffe biologischen Ursprungs sein. Ethanol wird weiter den Sektor beherrschen. 2007 erzeugten 20 Öl-fördernde Länder Treibstoff für über 200 Länder. Für 2020 wird erwartet, dass etwa 200 Nationen irgendein Programm zur Produktion von Biokraftstoff haben werden. Dies könnte als der größte Wandel einer globalen Industrie in lokale Plattformen für den Handel und die Entwicklung gelten.
Die erste Generation von Biokraftstoff stand in Konkurrenz mit dem Lebensmittelanbau wie Mais, Soja, Zuckerrohr, Raps und Palmöl. Die zweite Generation Biokraftstoff konzentriert sich auf alternative land- und forstwirtschaftliche Quellen. Brasilien hat die größte Vielfalt von erneuerbaren Kraftstoffquellen: heimisches Babassu (eine Palmenart) und Cupuassu (eine Kakaovariante), Soja, Rizinusöl, Palmöl, Baumwolle, Sonnenblume, Kokosnuss, Erdnüsse, Raps, Algen, Zellulose und Zuckerrohr. Mehrere Länder haben die Jatropha curcas aus Lateinamerika eingeführt. Die weiträumigsten Initiativen liegen in Indien (über eine Million Hektar), Mosambique (300 000 Ha), Indonesien (200 000 Ha) und Brasilien (100 000 Ha). Indien hat 60 Millionen Hektar ungenutztes Land reserviert und beabsichtigt, 20 Prozent aller Biokraftstoffe durch Jatropha zu ersetzen. In Kolumbien wurde erstmals Treibstoff aus Pinien (Terpentin) gewonnen, der mittlerweile das Interesse Bhutans geweckt hat. Dieses Land hat per Verfassung 60 Prozent seiner Fläche als Primärwald, hauptsächlich Kiefernwald, unter Schutz gestellt.
Im Jahr 2012 gibt es in mindestens 30 Ländern bereits Mischvorschriften und 29 regionale Regierungen sind ihren Entscheidern auf nationaler Ebene zuvor gekommen und haben lokal Biokraftstoffgemische im Angebot. Im Jahr 2010 stellten die USA, Brasilien und die EU zusammen 85 Prozent der globalen Produktion. Es gibt keine klaren Marktführer, und viele Firmen versuchen sich zu positionieren: die größten Anlagen bauen derzeit Neste (Finnland) in Singapur sowie Tyson-Conoco in den USA, mit einer Produktionskapazität von 250 bzw. 200 Millionen Gallonen. Ein Trend zur Massenproduktion zeichnet sich also ab. Auf der anderen Seite des Spektrums haben Ingenieure wettbewerbsfähige kleine Biodiesel-Anlagen für täglich 2000 Liter Biokraftstoff aus lokal erzeugten Rohstoffen entwickelt, die den ökologischen Fußabdruck durch Einsparungen der Transportkosten drastisch vermindern. Mit dem Bau von 150 Kleinanlagen in zwei Jahren schafft die Firma Extreme Biodiesel (Kalifornien, USA) die Basis für lokale Kooperativen, die den Zusammenschluss von Einzelherstellern fördern und Konzerne unterstützen, die den Wechsel zu erneuerbaren Treibstoffen wagen wollen.
Biokraftstoffe haben eine hohe Energieausbeute und reduzieren dabei den Ausstoß von Kohlendioxid (-78%), Schwefel (-100%), Kohlenmonoxid (-48%), Feinstaub (-47%) und Kohlenwasserstoffen (-85%). Bekannt ist, dass sich Kraftstoffe auf Maisbasis ohne massive Subventionen der US-Regierung auf dem Markt nicht tragen. Die Industrie sucht nach besseren Wegen der Konversion, unter anderem durch die Einführung des Bioraffinerie-Konzepts (Siehe Beispiel 6). Der Ethanolsektor ist sich bewust, dass für jeden Liter Treibstoff 10 Liter flüssige Abfälle entstehen. In Folge dessen erschöpft eine hohe dichte großer Anlagen schnell die Wasservorräte vor Ort. Die neun Kali-basierten Ethanolfabriken in Kolumbien suchen nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten für ihr Abwasser. Auf breiter Ebene besteht die Sorge, dass in ländlichen Gemeinden der Anteil an Anbauflächen für Biokraftstoff außer Kontrolle gerät und die Bauern gezwungen werden, große Flächen für Monokulturen ohne Rücksicht auf Energieaufwand, lokalen Lebensmittelbedarf oder gesundheitliche Risiken anzulegen.
Dr. Sean Simpson blickt auf eine breit angelegte Karriere in der Biologie und Biochemie zurück. Der gebürtige Brite hat an der Teeside University (Vereinigtes Königreich) seinen Bachelor of Science mit Schwerpunkt auf Biotechnologie und seinen Mastergrad an der University of Nottingham (Vereinigtes Königreich) in Pflanzengenetik erlangt. Seine akademische Karriere krönte er mit einem PhD in Pflanzen-Biochemie der University of York. Mittlerweile lebt er in Neuseeland. Zu Beginn seiner beruflichen Karriere arbeitete er in der Entwicklung von Medikamenten bei Hoffmann La Roche in der Schweiz und Sandoz in Österreich, dann untersuchte er Zellstrukturen an der Universität Tsukuba in Japan, bis er schließlich nach Neuseeland übersiedelte und dort beim Konzern Genesis an der Umwandlung von Hartholz in Ethanol zu arbeiten. Er fand eine Mikrobe, die imstande war, Kohlenstoff aus Gasen als Energiequelle zu nutzen und diese Kohlenstoffenergie in Treibstoff umzuwandeln. Diese Forschung mündete in einen Bericht, der bestimmte Bakterien im Verdauungstrakt einer speziellen Kaninchenart vorstellte, die möglicherweise Abfallstoffe in Treibstoffe umwandeln könnten. Kaninchen haben eine besondere Art der Verdauung: Zunächst kauen sie 300-Mal und verarbeiten dann, nachdem die ersten Nährstoffe extrahiert wurden, im Plumpdarm, in dem durch Enzyme und Bakterien die Überreste der Nahrung für die erneute Verdauung vorbereitet werden. Dieser unglaubliche und einzigartige Mix aus Mikroorganismen im Plumpdarm inspirierte den Forscher für sein nächstes Unterfangen, aus Abfällen Treibstoff zu gewinnen.
Dr. Simpson war klar, dass die erste sowie die zweite Generation Biokraftstoffe direkt oder indirekt (über die Anbauflächen) mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren. Zwar ist die zweite Generation breiter gefächert und weiter entwickelt als die einfache Nutzung von Lebensmitteln für Menschen als Kraftstoffquelle, doch es handelt sich weiterhin um die Nutzung von Landflächen, die alternativ auch Hanf oder Nesseln hervorbringen könnten. Dr. Simpson entwarf eine neuartige Fermentation, die Kohlenmonoxid-haltige Gase einfängt und den Kohlenstoff in Treibstoff und weiter Chemikalien umwandelt. Sein Denken folgt der Idee der Bioraffinerien und er erforscht das Potential der Umwandlung von Abfallströmen aus Industrien und Landwirtschaft, die gegenwärtig Luft, Wasser und Boden belasten und so das Klima gefährden. So bietet er eine völlig neue Vision, wie die Gewinnung von Kohlenstoff zur Grundlage einer Strategie für erneuerbare Treibstoffe werden könnte. Seine ursprünglichen Rechnungen zeigen auf, dass diese Technologie mit einem möglichen Ertrag von über 400 Milliarden Litern pro Jahr das Potenzial hat, die Zukunft der Kraftstoffproduktion mitzubestimmen und neue Rohstoffe für die chemische Industrie bereitzustellen.
Eine Analyse der Stahlindustrie hat gezeigt, dass aus den Emissionen der Produktion von jährlich 1,4 Milliarden Tonnen Stahl durch diesen neuartigen komprimierten Fermentationsprozess 115 Milliarden Liter Ethanol gewonnen werden könnten. Dr. Simpson wurde daraufhin zum Mitgründer von LanzaTech in Neuseeland dank der Unterstützung durch einige private Investoren. Im Jahr 2008 wurde eine Pilot-Anlage an die BlueScope-Stahlfabrik in Neuseeland angeschlossen, die erfolgreich Kohlenmonoxid und weitere Gase in zunächst 208 000 Liter Ethanol umwandelte. Diese erste Erfahrung motivierte die in China ansässige Firma Baosteel, eine Vorführanlage zu bauen, die die Produktion auf jährlich 380 000 Liter Ethanol steigerte. Die Anlage ist seit Herbst 2011 in Betrieb. Die verfügbaren Daten waren überzeugend genug, um den Betrieb dieser kleinen Anlage auszuweiten auf eine kommerzielle Produktion, die Abgase aus der Stahlindustrie in bis zu 250 Millionen Liter pro Jahr umwandeln kann. Die privaten Investoren wurden mittlerweile durch institutionelle und industrielle Partner aus Malaysia, Indien, China und den USA abgelöst. LanzaTech hat inzwischen Niederlassungen in den USA und China.
Zwar ist Europa bisher zweifellos Marktführer für Biokraftstoffe, doch LanzaTech hat bereits seine Kooperationsprogramme auf Indien (Indian Oil, Jindal Steel and Power), Malaysia (Petronas) und Japan (Mitsui & Co.) erweitert. Der erfolgreiche Betrieb der Vorführanlagen sowie die daraus folgenden Finanzierungen brachten LanzaTech den Titel „Firma des Jahres im Asien-Pazifik-Raum“ ein und Dr. Simspon wurde als „Nachwuchs-Biotechnologe des Jahres“ geehrt. Die möglichen Weiterentwicklungen beschränken sich nicht nur auf Abgase aus Stahlfabriken; LanzaTech ist ebenso bereit, die Abfallströme aus der Herstellung von Petrolkoks sowie aus der Landwirtschaft weiterzuverwerten. Allein die in den USA anfallenden 1,3 Milliarden Tonnen Biomasse könnten durch einen Ertrag von jährlich 720 Milliarden Litern den Mais als Biokraftstoff ein für allemal verdrängen, und das ohne den Bezug von Subventionen in Milliardenhöhe, die der Mais-Ethanol momentan verschlingt.
Dr. Simpson beschränkt sein Portfolio von Chancen nicht, und es scheint, für das Team von LanzaTech ist das erst der Anfang (so enden alle Fabeln von Gunter Pauli). Er hat die Möglichkeit der kontinuierlichen Nutzung von CO2 in einem Fermentationsprozess bewiesen, in dem Acetat gewonnen wird. Außerdem sind da die großen Mengen von Feststoffabfällen aus der Land- und Forstwirtschaft, städtische Abfälle (siehe Beispiel 51) und sogar die Abfälle aus der Kohleverarbeitung, die gleich wie die Emissionen der Stahlindustrie weiterverarbeitet werden können. Die Prozesse zur Umwandlung gemäß den Konzepten von Dr. Simpson schließen die Rückgewinnung von Abwasser ein, während alle Nebenprodukte zu Rohstoffen für die Chemieindustrie werden, ebenso wie in den Raffinerien Nebenprodukte aus Erdöl gewonnen werden. Ein Prozess, in dem Emissionen und Feststoffabfälle inspiriert durch natürliche Prozesse der biologischen Fermentation in Kraftstoff und Rohstoff umgewandelt werden, ohne dass Subventionen benötigt oder die Lebensmittelproduktion verdrängt werden, ist ein konkretes Beispiel für die Blue Economy. Zwar können kleine oder einzelne Investoren solche Anlagen nicht mittragen, doch sicher ist, dass jedes Land, in dem Kohleabbau und Landwirtschaft betrieben sowie Stahl hergestellt wird, diese Technologie einführen könnte, die schon bald durch Bakterien eine Plattform für den Wettbewerb auf dem Markt der Biokraftstoffe bilden wird.
Bilder: Stock.XCHNG
https://www.flickr.com/photos/jcapaldi/7823435568