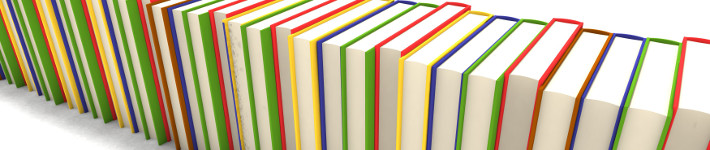87 Plastik aus Umweltverschmutzung
Dieser Artikel stellt einen neuen Ansatz für CO2 vor, eine von 100 Innovationen im Rahmen von „The Blue Economy”. Dies ist Teil einer breit angelegten Bewegung für mehr Unternehmertum, Wettbewerb und Arbeitsplätze.
Der Kohlenstoffmarkt wird weltweit mit 98 Milliarden Euro für 2011 beziffert, das bedeutet eine Steigerung um vier Prozentpunkte gegenüber 2010. Der EU-Emissionshandel (ETS), der weltgrößte Kohlenstoffmarkt, liegt bei 76 Milliarden Euro. Das gesamte Handelsvolumen an Emissionsberechtigungen (EUA) hat letztes Jahr 6 Milliarden Tonnen erreicht, eine 17-prozentige Steigerung gegenüber 2010. Dabei fielen die Preise auf 6,3 Euro pro Tonne und damit auf die Hälfte des Vorjahrs. Die von der UN ausgegebenen Emissionsreduktionsgutschriften (CER) wurden für letztes Jahr mit 17,8 Milliarden Euro beziffert, 2 Prozent weniger als 12 Monate zuvor. Auch der nordamerikanische Markt fiel von 367 auf 221 Milliarden Euro für 2011.
Zwar hat Kohlenstoff seinen Preis angesichts des Klimawandels, doch es gibt auch einen Markt für gereinigtes Kohlendioxid (CO2). Der CO2-Markt für die Nutzung in Krankenhäusern erreicht 2017 voraussichtlich einen Wert von 292 Millionen Dollar. Der größte industrielle Verbraucher von CO2 ist die Getränkeindustrie. Das CO2 macht die Getränke saurer, geschmacklich ansprechender und das Kohlenstoffgas dient gleichzeitig der Konservierung. Da die Getränke bei tiefen Temperaturen mehr CO2 binden können als bei höheren, empfehlen die Hersteller, dass ihre Produkte so kalt wie möglich serviert werden sollen, um dem Kunden mehr Geschmack bieten zu können. Eine Firma wie Pepsi hat eine Milliarde Kästen kohlensäurehaltige Cola verkauft und damit schätzungsweise 160 000 Tonnen reines CO2 verbraucht. Weltweit werden weit über eine Million Tonnen CO2 in Getränke gepumpt, die später nach und nach wieder in die Umwelt gelangen. Die Kosten für verflüssigtes reines CO2 erreichen im Fabrikverkauf bis zu 2 Euro pro Kilo.
Die ersten Versuche, den hohen Ausstoß von Emissionen aus der Energieerzeugung und Industrie durch fossile Brennstoffe an diese industriellen Bedürfnisse zu koppeln, wurden von allen Beteiligten mit Begeisterung aufgenommen, bis Probleme in der Qualitätskontrolle die Industrie zwangen, sich wieder zurückzuziehen aus der Wiederverwertung niedrig konzentrierten CO2 aus der Energieerzeugung, industriellen und landwirtschaftlichen Prozessen wie der Gewinnung von Magnesium aus Dolomit oder der Kalkverbrennung zur Herstellung von Zement. Die Aufgabe dieser Möglichkeit der Kanalisierung von einer Million Tonnen CO2 aus der Umwelt in die Industrie öffnete wiederum neue Wachstumsmöglichkeiten für traditionelle Gasfirmen wie Air Liquide, den größten Lieferer auf dem Sektor mit fast 5 Milliarden Euro an Umsätzen.
Die Nutzung von CO2 als Nebenprodukt industrieller und landwirtschaftlicher Prozesse erfordert neue Erkenntnisse, da die Entdeckung verseuchten Kohlenstoffs in Coca Cola aus Belgien großes Aufsehen hinsichtlich der Qualitätskontrolle der großen Hersteller erregte. Zwar gibt es viele Firmen, die in der Lage sind, die Konzentration und Aufreinigung von lebensmitteltauglichem CO2 zu übernehmen, doch das Lieferkettenmanagement der multinationalen Konzerne zieht es vor, das Gas aus der Wasserstoff- oder Ammoniakproduktion aus Erdgas oder Kohle, mittlerweile auch aus der Fermentation von Zuckerrohr für Ethanol zu gewinnen. Bei der Ethanolherstellung aus Mais werden ebenfalls große Mengen CO2 freigesetzt und zunehmend industriell weiterverwertet, doch leider steht dies im Konflikt mit der Nahrungsmittelproduktion. Daher kann diese Produktionsform nicht als nachhaltig bezeichnet werden, auch wenn die Rohstoffe biologischen Ursprungs sind.
Geoffrey Coates wurde in Evansville, Indiana geboren. Seinen Abschluss in Chemie erlangte er am Wabash College (Indiana) und 1994 schloss er das Studium der anorganischen Chemie an der Stanford University in Kalifornien ab. Seit 1997 ist Geoff Mitglied der Cornell University Faculty. Als Leiter des Bereichs der Synthese von Polymeren mit Schwerpunkt auf katalytischen Umwandlungen machte er akademische Karriere. Er beobachtete, das der für etwa 30 000 chemische Verbindungen genutzte Kohlenstoff weltweit von etwa 300 chemischen Zwischenprodukten herrührte. Letztlich kamen all diese Zwischenmoleküle aus fossilen Brennstoffen. Geoff war interessiert daran, neue Wege zu finden, wie erneuerbare biologische Ressourcen in Polymere umgewandelt werden könnten. Er fand heraus, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht in der Verfügbarkeit der Rohstoffe bestand, sondern eher in der Erkennung von Katalysatoren, die die erforderliche Reaktivität zur Polymerisierung von CO2 erbrachten.
Kohlendioxid ist ein ideales Ausgangsmaterial; es ist reichlich vorhanden, billig, wenig giftig und nicht brennbar. Geoff beobachtete, dass die Natur CO2 zur Produktion von jährlich über 200 Milliarden Tonnen Glukose durch Photosynthese nutzt, doch bis vor kurzem hatten die Chemiker wenig Erfolg bei der Entwicklung eines Prozesses, der diesen attraktiven Rohstoff ausnutzt. Geoff und sein Team entwickelten Katalysatoren auf Zink- und Kobaltbasis, die CO2 unter milden Bedingungen in einen Ausgangsstoff für chemische Produkte umwandeln. Es bleibt noch die Herausforderung, sowohl die zink- als auch die kobaltbasierten Katalysatoren zurückzugewinnen, um einen echten Kreislauf zu schaffen, der unseren bereits exzessiven Bedarf nach Bergbau nicht noch weiter in die Höhe treibt.
Geoff baute ein starkes Forschungsteam an der University of Cornell auf. Doch die Bandbreite und Tiefe dieser Katalysatoren sowie die Notwendigkeit, diesen innovativen Ansatz für Polymere aus Treibhausgasen marktfähig zu machen, erforderte besondere Aufmerksamkeit. Er gründete daher Novomer (Neue Polymere) auf Grundlage einer exklusiven Lizenz auf die Patente für Katalysatoren aus Cornell und brachte Investitionen in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar auf, unter anderem von der holländischen Chemiegruppe DSM. Dies war ein idealer Partner auf der Suche nach Innovationen, da dessen Management beschlossen hatte, bis 2015 50 Prozent seiner Gesamtverkäufe aus Ökoprodukten zu erzielen. Physics Ventures, die Tochterstiftung von Unilever, brachte ein ebenso großes Investitionsvolumen auf.
Das Team von Novomer hat erfolgreich die Katalysationstechnologie von der Labor- auf die Vorführungsebene geführt und entwickelt nun Methoden zur Produktion von Chargen sowie kontinuierlicher Massenproduktion. Das Portfolio an Geschäftschancen ist so breit, dass die Produktentwickler die CO2-basierten Polymere in einer großen Bandbreite von Anwendungen testen, darunter Thermoplastik, Bindemittel, Elektronik, Überzüge, Netzmittel und Schäume.
Die Möglichkeit, Flaschen aus Blasformen zu ersetzen, weckte nicht nur die Aufmerksamkeit von DSM, sondern auch von Unilever, einem der weltgrößten Verbraucher von Plastik. Die von Unilever durchgeführten Tests sowie dessen erklärtes Interesse an dieser neuen Weise, Umweltverschmutzung in Plastik umzuwandeln, konnte Novomer nutzen, um von der Energiebehörde der USA eine Förderung in Höhe von 18,4 Millionen US-Dollar zu erhalten, um die Markteinführung weiter voranzutreiben. Die Testproduktion von extrudiertem Dünnfilm bot weitere Motivation, um auch Verpackungen aus Umweltverschmutzung herzustellen. Geoff und sein Team bekamen bereits den nötigen finanziellen Spielraum, um die Produkte und Produktionsprozesse weiterzuentwickeln.
Unilever sieht große Vorteile in der Produktion von kostengünstiger Verpackung ohne Subventionen, Kohlenstoffsteuern oder Strafabgaben, nicht weil die Firma dagegen wäre, sondern weil die Zukunft dieser politischen Entscheidungen unsicher ist und ein Unternehmen daher nicht auf Innovationen als strategischer Option bauen kann, solange deren endgültiges Schicksal durch Politik und internationale Abkommen bestimmt wird.
Novomer besitzt eine Plattformtechnologie, die über Verpackungen hinaus geht. Sie könnte Hunderte von Produkten von Windeln bis hin zu Wandfarben betreffen. Jetzt sehen wir die Chancen, Technologiecluster durch diese innovative Plattform auf der Basis neuer Erkenntnisse über Katalysatoren zu bilden. Wettbewerb auf dem Markt ohne Subventionen, Umwandlung von Abfällen in Ressourcen und vielleicht sogar Zahlungseingänge durch CO2-Abbau sind typische Merkmale, die den Ansatz der Blue Economy untermauern.
Bilder: Stock.XCHNG