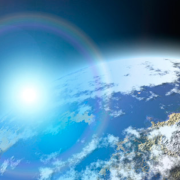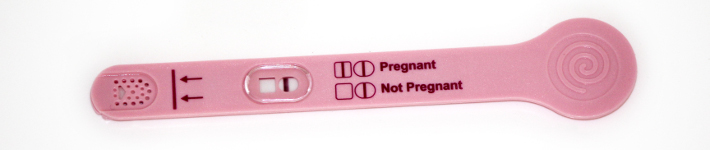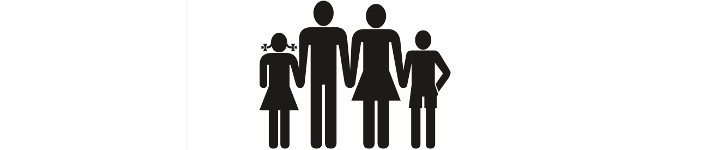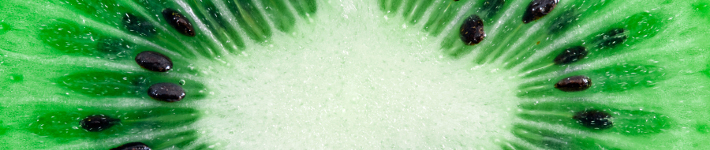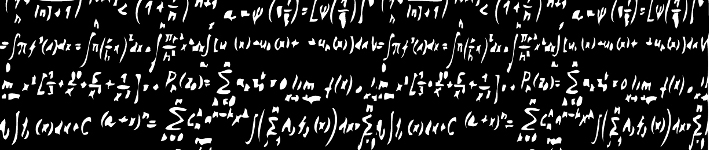Stroh - der nächste ökologisch-innovative Trendsetter
Dieser Artikel diskutiert Verwendungsmöglichkeiten für Stroh und geht dabei besonders auf den derzeitigen Stand der Technik ein. Es handelt sich dabei um eine der vielen Innovationen, die die Blue Economy bestimmen und Teil einer breiten Entwicklung für ein positives Gleichgewicht zwischen Mensch, Wirtschaft und Natur ausmachen.
Von Markus Haastert, Anne-Kathrin Kuhlemann
Hintergrund: Biomasse und natürliche Ökosysteme
Die Anstrengungen für eine Verringerung der Auswirkungen Schaden verursachender Aktivitäten des Menschen müssen weiter forciert werden. Die EU hat betont, dass Innovation nicht immer nur neue Materialien betrifft, sondern auch das Finden neuer Ansätze bei „alten“ Rohstoffen. Kann man sich vorstellen, dass Stroh, einer der am wenigsten genutzten Abfälle aus der Landwirtschaft, eine führende Rolle in der Energiegewinnung und Bauwirtschaft der Zukunft spielt? Wenn, dannkönnte der globale Treibhausgasausstoß bis 2050 um 20% zurückgehen, wodurch das Risiko einer weiteren Degradierung der Umwelt vermindert würde. Der im Trend liegende innovative und nachhaltige Gebrauch von Stroh könnte daher Teil einer herbeigesehnten Entwicklung sein.
Unsere Ökosysteme liefern reichlich natürliche Abfallbiomasse aus der Veredelung von Wald, Holz und Agrarprodukten. Während der Kompostierung wird dieser organische Abfall in wertvolle Nährstoffe verwandelt. Durch die Akkumulation von organischem Material verbessert sich die Qualität der Böden insgesamt.So hat die Kompostierung äußerst positive Auswirkungen für zum Beispiel die Agrarwirtschaft, da sie die Nährstoffe für das Pflanzenwachstum bereitstellt. Darüber hinauswerden während der Kompostierung sowohl Unkrautsamen als auch pflanzliche und menschliche Pathogene zerstört. Um die Erde mit Nährstoffen anzureichern und einen stabilen Kompostierungsprozess zu erzeugen, werden Strohrückstände aus der Agrarwirtschaft oft der Kompostierung zugeführt. Stroh ist besteht überwiegend aus Zellulose, Hemizellulose und Lignin. Diese Bestandteile geben Pflanzen Stabilität und Haltbarkeit und sind weitestgehend zerfallsresistent. Wenn lokale Vorschriften Erosions- oder Konzessionen zur Bodenqualitätskontrolle erfordern, reichern Landwirte ihre Böden mit 1 bis 2% Strohhäcksel an und machen sich diese zerfallsresistenten Pflanzenkompoenten zu Hilfe um Erosion vorzubeugen (Brewer et al, 2013).
Weltweit gibt es einen enormen Überschuss an ungenutztem Strohabfall. China allein produzierte in 2005 mehr als 620 Milliarden Tonnen Stroh. Dabei führt das Land die Liste der größten Produzenten von Stroh- und Reisstrohabfall an, dicht gefolgt von Indien und denVereinigten Staaten (Mantanis et al, 2000). Aufgrund des Überschusses bietet sich die Verwendung von Stroh zur zum Beispiel der Energiegewinnung an, da es zum Umweltschutz beiträgt und die nachhaltige Entwicklung einer ständig wachsenden Wirtschaft fördert. (Zeng & Ma, 2005)
Es gibt Landwirte welche die Produktion von Stroh als Risiko betrachten, da die Halme bei Sturm oder starkem Wind brechen können. Daher wurden Arten mit kürzeren Halmen entwickelt, um eine maschinelle Ernte zu erleichtern und gleichzeitig die Gefahr von Ernteausfällen durch Windbruch zu verringern. Langhalmiges Stroh, das Hagel ausgesetzt war, brach bei starkem Wind schneller und ist außerdem anfälliger für Krankheiten. (Paulsen, 1997). Landwirte ziehen daher kurzhalmige Getreidesorten vor, was auch dazu führt, dass weniger Biomasse als Abfall anfällt. Dadurch nimmt die Menge an Strohabfall konstant ab, was sich indirekter Weise negativ auf die Umwelt auswirkt.
Uns allen ist Stroh als Beiprodukt aus der Agrarwirtschaft bekannt: die trockenen Halme, die nach dem Dreschen auf dem Feld oder Hof zurückbleiben. Sie machen circa die Hälfte der Gesamtmasse beim Getreideanbau, wie Hafer, Roggen, Gerste usw. aus. Nach der Ernte werden sie gesammelt und in Strohballen gepresst. Es mag überraschen, dass dieses Beiprodukt, obwohl ihm für gewöhnlich kein großer Wert beigemessen wird, für eine ganze Reihe von Produktionsketten eingesetzt werden kann. Darunter vor allem die Energiegewinnung und die Bauindustrie.
Innovation: Vom Nahrungsmittel zu kohlenstoffnegativen Gebäuden
Der historische und auch moderne Gebrauch von Stroh mag durchaus überraschen. Wir kennen Stroh als ballaststoffreichen Tierfutterzusatzfür Rinder und Pferde. Es kommt in der Korbmacherei zum Einsatz, als Rohstoff zur Herstellung von Bienenkörben, Wäschekörben und als Streu für die Viehhaltung. Auch Strohmatratzen, sogenannte Palliassen, werden nach wie vor in vielen Teilen der Welt gebraucht. Der positive Effekt, den Stroh auf die Gesundheit hat, ist auf das in ihm enthaltene Silikat zurückzuführen, welches besonders in Roggen und Reis vorkommt. Silikat in seiner Form als Silikonkarbid (SiC) findet Verwendung in den verschiedensten Industrien, von Elektrotechnik bis Schmuckproduktion. Stroh selbst wird eingesetzt in der Erosionskontrolle auf Baustellen, zur Hutherstellung, für Gurkenhäuser, beim Anbau von Pilzen, in Bodenlockerungsmischungen, für Seile, Schuhe, insbesondere für die koreanischen Jipsinsandalen, zur Herstellung von biologisch abbaubaren Verpackungen und in der Papierherstellung.
Darüber hinaus wird Stroh auf der ganzen Welt als sicherer, energieeffizienter und nachhaltiger Rohstoff für die Bauindustrieverwendet. Das Material ist lokal verfügbar und bietet eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu teuren und umweltschädlichen Baustoffen. In der Volksrepublik China liegt es im Trend, Häuser und öffentliche Gebäude aus Reisstrohabfall zu errichten. So gab es im Jahr 2005 bereits 600 dieser Häuser, welche insbesondere mit Blick auf die Umweltverträglichkeit erstaunliche Vorteile aufweisen. Sie reduzieren den Kohleverbrauch und den CO2 Ausstoß drastisch, verringern das Risiko von Atemwegsinfektionen, sind erdbebenresistent, uvm.

In Litauen ist das Ecococon-Strohpaneel ein gutes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von Stroh in der Bauindustrie. Die Paneele sind aus gepresstem Stroh gefertigt und werden von einem Holzrahmen zusammengehalten. Nach dem Überzug mit einer wasserabweisenden Schicht werden sie wie gewöhnliches Mauerwerk verputzt. Die Häuser sind für einenjahrzehnte-, ja jahrhundertelangen Gebrauch geeignet. Die Bauweise erfordert keinen Beton oder den Einsatz von schweren Baumaschinen. Wird das Haus nicht mehr gebraucht, kann es einfach abgetragen und die Baumaterialien der Wiederverwertung zugeführt werden. Damit kommt es nicht zu der Umweltbelastung die mit dem Abbruch von Ziegelhäusern Hand in Hand geht, was zu einer gesünderen Umwelt beiträgt.
Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Anwendung findet sich in der englischen Stadt Bradford, wo ein ganzer Business Park aus Stroh errichtet wurde. Der Inspire Bradford Business Park besteht aus zwei Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 2.800 qm und bietet Räumlichkeiten für gemeinschaftliche Räume, Werkstätten, Büros und ein Café. Damit ist der Park momentan Europas größter Strohkomplex. Er wurde in Übereinstimmung mit nachhaltigen Prinzipien gebaut und entspricht den Energieeffizienzwerten der Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
Die Bedeutsamkeit des Potenzials von Stroh als Baustoff der Zukunft ist enorm. So unterstützt beispielsweise die EU das EUROCELL-Projekt mit €1,6 Mio. aus ihrem Competitiveness and Innovation Programme(CIP). Das Projekt richtet sich an die Ausarbeitung eines Zertifikats für den Strohpaneelbau was als Basis für die Marktentwicklung und die öffentliche Akzeptanz dieser Baumethode dienen soll. Es ist wichtig hervorzuheben, dass Modcell als Partner an diesem Projekt beteiligt ist. Modcell ist einer der ersten Produzenten welcher kohlenstoffnegatives Bauen kommerziell und in nennenswertem Ausmaß betreibt. Bei der Herstellung des Strohball- und Hanfpaneels bedient sich das Unternehmen insbesondereden hervorragendenisolierenden Eigenschaften dieser Rohstoffe. Damit wird der Bau von super-isolierten, hochleistungsfähigen Niedrigenergiehäusern mit erneuerbaren, kohlenstoffbindenden und lokal verfügbaren, nachhaltigen Ressourcen möglich gemacht.
Potenzial: Energiequelle
Die meisten ökologisch orientierten Entwicklungsagenturen der Welt experimentieren derzeit mit Stroh als Treibstoff im Energiemix der Zukunft. In Deutschland sind die Forschungsergebnisse des TLL (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft), des DBFZ (Deutsches Biomasseforschungszentrum) und des UFZ (Helmholtz Zentrum für Umweltforschung) vielversprechend.
Die Studie geht davon aus, dass von insgesamt 30 Millionen Tonnen jährlich anfallenden Getreidestrohs zwischen 8 und 13 Millionen Tonnen für die Herstellung nachhaltiger Energie oder Biotreibstoffegenutzt werden könnten. Das unterstreicht zweifellos die Rolle, die Stroh als Quelle für erneuerbarer Energie spielen könnte. Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass man 1,7 bis 2,8 Millionen Haushalte mit Elektrizität versorgen könnte bzw. 2,8 bis 4,5 Millionen Haushalte beheizen könnte.
Insgesamt tut sich also eine potenzielle energie- und umweltschonende Alternative zur derzeitigen Energieproduktion auf. Stroh könnte die steigenden Nachfrage für Elektrizität, die bis 2025 auf ein Niveau 2,7 mal höher als 2015 anwachsen soll, zum Tel bedienen. In Zukunft müssen 90% der Energie aus nicht fossilen Quellen gewonnen werden. Durch ein simples Umrüsten von Kohlekraftwerken könnte man dort Stroh als Energiequelle nutzen.Klingt das wie ein Sisyphusprojekt?
Die Eigenschaften von Stroh sind so vielfältig, dass die Nachfrage an diesem Rohstoff in Zukunft zunehmen wird. Daher muss der Trend weg von der Kurzhalmigkeit und hin zu Langhalmigen Getreidesorten gehen. Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen winter-, wind-, sturm- hagelresistente Arten zu entwickeln, gibt es viele (Limagrain Cereal Seeds, 2010). Es beibt zu hoffen, dass sie den Fokus dabei auf stärkere Halme richten. Es werden immer wieder Weizensorten entwickelt, die in den Vereinigten Staaten durch das NVT (National Variety Trials Project) und das DAFWA (Department of Agriculture and Food) getestet werden (Shackley et al, 2014). Dabei ist die Entwicklung von Sorten mit längeren Halmen und größerer Resistenz und Widerstandskraft wünschenswert. In Kombination mit traditionellen Anbaumethoden, wie dem Einsatz von Hecken an Feldrändern, wäre so eine Verfügbarkeit von Stroh auch bei steigender Nachfrage gewährleistet.

Stroh kann nicht nurals nachhaltiger Treibstoff im globalen Energiemix ein Beitrag zu Emissionsreduktionen leisten, sondern auch den mit der Bauindustrie einhergehenden Umweltschäden entgegenwirken. Diese Art der Verwendung von Stroh ist innovativ und umweltfreundlich und stellt eine neue Phase in der Öko-Erfindung dar. Neben des Beitrags zum Umweltschutz bietet sich die Verwendung von Stroh aus folgenden Gründen an: es ist verlässlich, nachhaltig, leicht transportabel, kostengünstig, kann lange gelagert und flexibel eingesetzt werden. Daher bietet Stroh eine Alternative mit großem Potential um den globalen Bedarf nach sauberer Energie zu decken und wird daher zu einer der wichtigsten Rohstoffe für die Öko-Innovationen der Zukunft.
Quellenangaben
Brewer, L., Andrews, N., Sullivan, D., & Gehr, W. (June 2013). Agricultural composting and water quality (EM 9053). Oregon State University Extension Service. Verfügbar unter
http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/39040/em9053.pdf
Paulsen, G. (May1997). Growth and development. Wheat production handbook. Kansas State University Agricultural Experimental Station and Cooperative Extension Service. Verfügbar unter
http://www.caes.uga.edu/commodities/fieldcrops/gagrains/documents/c529.pdf
Mantanis, G., Nakos, P., Berns, J., & Rigal, L. (2000). Turning agricultural straw residues into value-added composite products: a new environmentally friendly technology. Verfügbar unter: http://users.teilar.gr/~mantanis/research.files/G1.pdf
Shackley, B., Zaicou-Kunesch,C., Dhammu, H., Shankar, M., Amjad, M., Young, K. (2014). Wheat variety guide for WA. Grains Research & Development Corporation. Verfügbar unter:
http://www.nvtonline.com.au/wp-content/uploads/2014/03/WA-wheat-variety-guide-2014-for-web1.pdf
Limagrain Cereal Seeds (2010). What we do. Breeders & development of varieties of wheat. Verfügbar unter: http://www.limagraincerealseeds.com/what-we-do
Zeng, X. & Ma, Y. (2005). Utilization of straw in biomass energy in China. Thermal Energy Research Institute, Tianjin University, Tianjin 300072, People’s Republic of China doi: 10.1016/j.rser.2005.10.003
Hedgegrows, ditches and open drains are designated as landscape features for the purpose of the single payment scheme. Department of Agriculture, Food and the Marine (Ireland). Verfügbar unter:
Economics and funding SIG (June 2007). Valuing the benefits of biodiversity. Verfügbar unter:
http://archive.defra.gov.uk/environment/biodiversity/documents/econ-bene-biodiversity.pdf
Healthy Garden Workshop Series, maximizing your harvest. United States Department of Agriculture. Verfügbar unter:
http://www.usda.gov/documents/Companion_Planting_and_Harvesting_Workshop_Handout.pdf
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/10/is-straw-germanys-next-big-energy-resource
http://www.inspirebradford.com/content/news/europe%E2%80%99s-largest-straw-bale-buildings-take-shape-inspire-bradford-business-park
http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?lang=00&theProjectID=292
Fotos (Quellen):
https://www.flickr.com/photos/zunami/2749249152/
https://www.flickr.com/photos/usdagov/8369765859