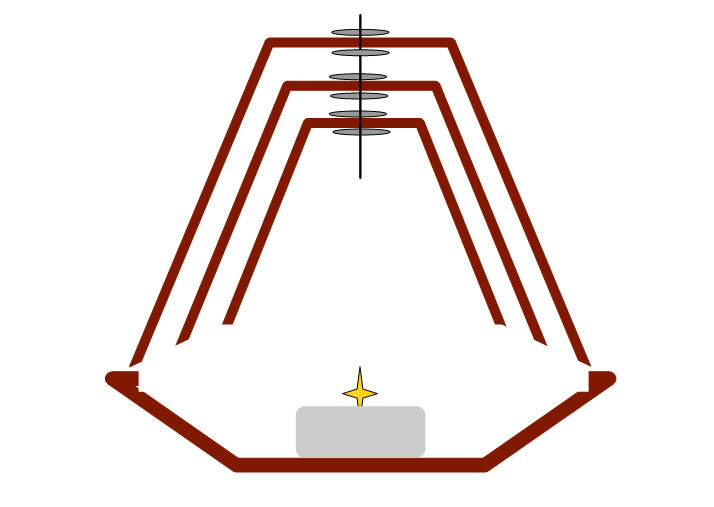InnWert
Innovations- und Wertschöpfungsprogramm für Ressourceneffektivität
Politik der Feuerwehreinsätze
Fukushima hat in Deutschland zum Wechsel der Energiepolitik geführt. Intensive Bemühungen zur Einsparung von Energie und zur Dämpfung der CO2-Emissionen sind eingeleitet. Die Frage ist: Sichern wir mit diesen und anderen jetzt laufenden Maßnahmen die nachhaltige Wohlfahrt der Zivilgesellschaft und die Zukunftsfähigkeit der Industrie? Denn noch immer zwingt uns die heutige Wirtschaftsweise, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Solange unsere Wirtschaft nicht in die Leitplanken der Ökosphäre eingebettet wird, sind unsere Zukunftschancen nicht sehr ermutigend.
Bis heute muten Umwelt- und Finanzpolitik leider an wie die Ausbesserung einzelner mehr oder weniger großer Schlaglöcher. Noch immer werden Schäden und Krisen nachsorgend einzeln und getrennt voneinander behandelt, so etwa Überschwemmungen, den Verlust von Arten, der Klimawandel, die Arbeitslosigkeit, der Bankenskandal, oder die “Rettung Griechenlands” . Und das geschieht oft auch noch mit gepumptem Geld zukünftiger Steuerzahler. Kein Politiker und keine Partei wagt sich bis heute an strategische und systemgerechte Vorsorge mit dem Ziel einer nachhaltigen Zukunft.
Ernsthaft zukunftsgerichtete Politik ist eine vorsorgende Politik, welche die Wurzeln wirtschaftlicher und ökologischer Fehlentwicklungen rechtzeitig korrigiert weil sie weiß, dass auch modernste Technik einmal zerstörte öko-systemische Funktionen und Dienstleistungen der Natur nicht reparieren oder ersetzen kann.
Wachstum und der Wert unserer Umwelt
Wir führen ein Leben, das in dieser Form auf einem begrenzten Planeten nur eine begrenzte Zeit lang möglich ist. Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und Nachhaltigkeit der Wirtschaft sind nur dann denkbar, wenn wir lernen, mit weniger natürlichen Ressourcen mehr Wohlstand für eine wachsende Zahl von Menschen zu erzeugen. Seit 20 Jahren wächst die Erkenntnis, dass die größte physikalische Bedrohung der ökologischen Verlässlichkeit die gigantische und unnötige Verschwendung von natürlichen Ressourcen ist [EU 1.]. Rund 30 kg Natur werden heute im Schnitt verbraucht, um 1 kg Technik zu schaffen, Wasser nicht inbegriffen. Und ohne die Hilfe dieser Technik sind auch Dienstleistungen nicht möglich. Über 90% der zur Schaffung von materiellem Wohlstand denaturierten Umwelt leisten demnach keinen Beitrag zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse und Träume.
Maximal erreichbare Ressourcenproduktivität ist die ökologische Währung für die Schaffung von nachhaltiger Wohlfahrt . Materielles Wachstum ist das Gegenteil. Heute noch kann grundsätzlich Jedermann Natur entnehmen, verbringen und gewinnbringend nutzen , ohne den angemessenen Preis hierfür zu entrichten. Schon heute bewegt der Mensch mit riesigem Energieaufwand weit über 100 Milliarden Tonnen Material jährlich, Wasser und gepflügte Erde nicht gerechnet. Das ist mehr als zweimal mehr als die Natur selbst schafft. Wir lernen daraus, dass die Menge eingesetzter Ressourcen pro Wohlfahrtsleistung ein weltweit messbarer Indikator ist für die potentielle Umweltzerstörung aller Güter und Dienstleistungen – der sogenannte „materielle Fußabdruck“. Ökologisch bedeutet dies, vor allem solche Entwicklungen zu beschleunigen, welche die Nutzung von natürlichen Ressourcen mindern.
Wir könnten dies zwar – ohne Wohlfahrt zu schmälern – technisch ziemlich schnell in den Griff bekommen . Dass mit gezielter Verbesserung der Ressourcenproduktivität bei Herstellern schon heute viel Geld eingespart werden könnte, haben Wirtschaftswissenschaftler bereits 2004 veröffentlicht. Ihnen zufolge könnten in den KMU’s Deutschlands im Schnitt etwa 20% der Kosten für eingesetzte Ressourcen ohne Qualitätsverlust des Outputs eingespart werden. Dabei geht es um über 150 Milliarden Euro im Jahr.
Sparen an Natur lohnt sich also – bisher erkennen jedoch die wenigsten Unternehmen die Vorteile einer erhöhten Ressourceneffizienz. Insofern muss hier von politischer Seite ein (zeitlich begrenzter) Anreiz gegeben werden. Es ist wissenschaftlich nicht möglich, die öko-toxischen Auswirkungen unserer Wirtschaft in den notwendigen Details zu ermitteln, oder gar im voraus zu berechnen, um damit vorsorgende Umweltpolitik zu gestalten. Wie alle Indikatoren geben Ressourcenproduktivität und -intensität die potentielle Umweltbelastungskapazität von Dingen nur näherungsweise wieder. Daher sind Verbote wenig zielführend.
Stattdessen müssten die Preise für die Nutzung von Natur den wirklichen Kosten angepasst werden. Denkbar ist zum Beispiel die (kostenneutrale) Verschiebung der finanziellen Belastung auf Arbeit hin zu natürlichen Ressourcen. Das schiene uns schon deshalb angebracht, weil Naturkapital zunehmend die für die Menschheit entscheidende Knappheit geworden ist. Erst wenn der Input natürlicher Ressourcen in den Metabolismus der Wirtschaft dem Prinzip des „full-cost-pricing“ entspricht, werden wir alle sehr viel behutsamer umgehen mit der Umwelt. Und Kennzeichnungen aus Umweltgründen sind dann weitgehend überflüssig, nur die „Giftigkeit“ von Dingen müsste noch angezeigt werden.
Neue Geschäftsmodelle
Aber wir sollten nicht nur das Sparen neu entdecken. Genau so wichtig ist es, aus den verfügbaren Ressourcen entscheidend mehr Mehrwert zu erzeugen, ganz generell. Das heute übliche Geschäftsmodell ist auf Wachstum, Economies of Scale, Core Business (Kerngeschäft) und Core Competence (Kernkompetenz) fokussiert und favorisiert die Spezialisierung und Konzentration auf ausgesuchte Märkte. Geschäftserfolge werden in Cash und Marktanteil bewertet und eben nicht nach ihrer Eignung, nachhaltigen Nutzen für den Verbraucher zu kreieren.
Wir brauchen offenbar dringlich ein neues Geschäftsmodell, welches die Annäherung an die Zukunftsfähigkeit unterstützen kann. Eine zentrale Voraussetzung hierfür ist, dass Grundbedürfnisse von Menschen z.B. an Lebensmitteln, Dienstleistungen und Ressourcen soweit wie möglich aus der Nähe in eigener Verantwortung befriedigt werden.
Wie man im Vergleich mit heute üblichen Gewohnheiten hundertfach mehr Wertschöpfung aus vorhandenen Ressourcen schöpfen kann, sei an einem Beispiel aus Gunter Pauli’s “Blue Economy” Sammlung dargelegt.
Von der Bohne bis zur guten Tasse Kaffee tragen nur etwa 0,2% der Pflanze bei. Anders gesagt, 99,8% muss entsorgt werden. Als Kompost oder als Verfeuerungsmasse wird das Potenzial dieses Abfalls nicht wirklich gehoben. Stattdessen können auf diesem Hartholz Edelpilze gezüchtet werden, nach deren Ernte die Überreste als Wurmfutter Verwendung finden, die Würmer wiederum als Fischfutter und der verbleibende Humus als Beeterde genutzt werden. So verbleibt kein Abfall, der entsorgt werden muss, es sind stattdessen drei neue Produkte und damit Einkommensströme samt Arbeitsplätzen entstanden. Diesem Beispiel folgen bereits Firmen in Berlin, San Francisco, Mexico City und Madrid – während Kaffeekonzerne das Effizienz-, Ressourcen- und Umsatzpotenzial ungenutzt liegen lassen, aber teures Geld für “Greenwashing” ausgeben.
Unter Blue Economy veröffentlichte Geschäftsmodelle veranschaulichen dabei, dass die Natur der effizienteste Ökonom unseres Planeten ist. Für alle Probleme gibt es dort bereits Lösungen, die weder Abfälle produzieren noch ungewollte Kollateralschäden bedingen. So können zahlreiche hochgiftige Bestandteile unserer Produkte, die bereits in der Herstellung enorme materielle Fußabdrücke mit sich bringen, schlichtweg durch “Nichts” ersetzt werden – beispielsweise Batterien durch natürliche Stromimpulse aus Temperaturdifferentialen. Auch die Orientierung an physikalischen Naturgesetzen als oberste Maxime ermöglicht ein kaum vorstellbares Potenzial, wenn z.B. Wasser allein durch Schwerkraft gereinigt wird (somit Chlor und teure Filter substituierend).
In der Summe ergeben sich Produkte, die sowohl billiger als auch besser sind – besser für jeden, also auch die Natur. Wir hoffen, dass schon sehr bald Politik wie Wirtschaft und Konsumenten erkennen, dass es bereits heute möglich ist, eine nachhaltige Zukunft zu leben. Dafür bedarf es lediglich des Umdenkens, nicht jedoch des bewussten Verzichts auf Wohlstand und Bedürfnisbefriedigung.
InnWert: Programm für ein Recht auf Zukunft
Um die bereits heute bekannten Möglichkeiten umzusetzen, bedarf es der Politik, die Anreize schafft. Ein umfassendes Innovations- und Wertschöpfungsprogramm für Ressourceneffektivität (InnWert) müsste beispielsweise beinhalten:
· Die vorsorgend frühzeitige Durchsetzung systemgerechter Lösungen, [EU 6.1] [12]
· Die gezielte Verbesserung der Ressourcenproduktivität, [EU 1., 6.1]
· Die Durchsetzung ehrlicher Preise auf dem Markt („full-cost-pricing“) [EU 3.4.2]
· Die wirksame Eigenhaftung in Politik und Wirtschaft,(Homburg)
· Die Vereinbarung ökologischer, sozialer, und wirtschaftlicher Ziele für eine stabile Zukunft, [EU 6.1]
· Die Festlegung von Indikatoren mit Bezug zur Umwelt in allen Politikbereichen [EU 1., 2. 6.1]
· Die Abschaffung verbrauchsfördernder Subventionen, [EU 3.4.1.]
· Die Verhinderung kurzfristiger Profitmaximierung,
· Die Verhinderung “Giftiger Produkte“ (Stiglitz), [EU 3.1.2.]
· Die Einrichtung von Frühwarnsystemen,
· Die Festschreibung verlässlicher Accounting-, Berichts-, und Kennzeichnungsmethoden. [EU 4.1]
Wir hoffen auf einen baldigen, parteiübergreifenden Dialog mit der Politik, denn die Zeit wird langsam knapp. Bereits im Juli 2010 kam eine Studie der Bundeswehr zu dem Schluss „dass das sehr ernst zu nehmende Risiko besteht, dass eine durch nachhaltige Knappheit von wichtigen Rohstoffen ausgelöste globale Transformationsphase von Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen nicht ohne sicherheitspolitische Friktionen vonstatten gehen wird. Die Desintegration komplexer Wirtschaftssysteme … hat direkte, teilweise schwerwiegende Auswirkungen auf viele Lebensbereiche, auch und insbesondere in Industrieländern.“ Und weiter: Der absehbare „Paradigmenwechsel widerspricht ökonomischer Logik und kann deswegen nur in begrenztem Umfang Marktkräften überlassen werden“.
Ohne die öko-systemischen Dienstleistungen und Funktionen, aus denen der Mensch entstand, kann er auf dem Planeten Erde nicht überleben. Wir alle müssen umgehend handeln, um unser aller Recht auf Zukunft, wie auch das Recht der Zukunft zu schützen.
FACTOR 10 INSTITUTE
BLUE ECONOMY INSTITUTE
Bild: Stock.XCHNG
Für einen Download des gesamten Textes als pdf klicken Sie bitte hier.