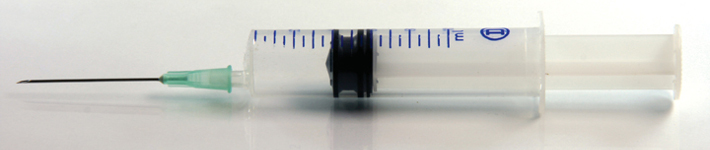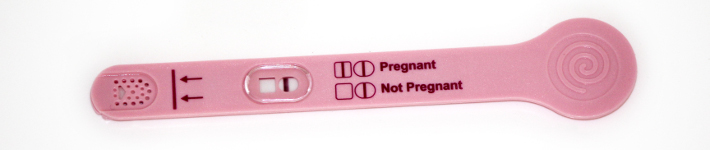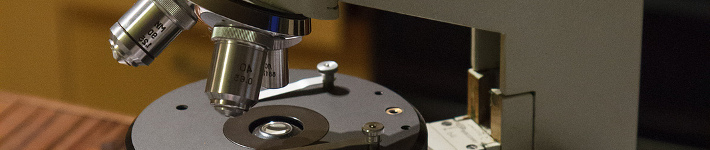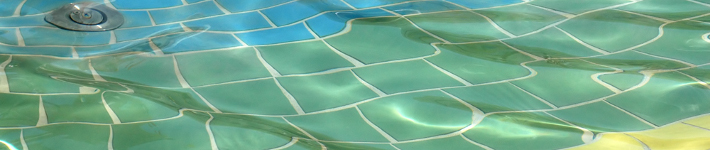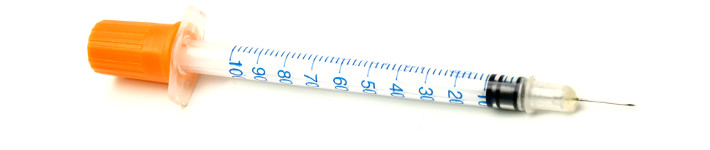90 Mehr Gesundheit als Medikamente
Dieser Artikel stellt einen kreativen Ansatz für die Gesundheitsversorgung vor, eine von 100 Innovationen im Rahmen von „The Blue Economy”. Dies ist Teil einer breit angelegten Bewegung für mehr Unternehmertum, Wettbewerb und Arbeitsplätze.
Der Weltmarkt für Antibiotika wächst Erwartungen zufolge von 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 bis auf 40,3 Milliarden Dollar für 2015. Trotz der Tatsache, dass die Industrie in letzter Zeit keine völlig neuen Antibiotika entdecken konnte, wird ein solch starkes Wachstum erwartet. Der Grund hierfür liegt eher in den günstigen Regulierungsbedingungen; die staatlichen Versicherungsprogramme sehen mehr Ausgaben für Medikamente vor angesichts der wachsenden Sorge vor Medikamentenresistenzen und der Wiederausbreitung von Krankheiten wie Tuberkulose, die als besiegt galten. Der größte Markt für Antibiotika sind die USA; dort hat sich der Konsum dieser verschreibungspflichtigen Medikamente in nur einem Jahrzehnt vervierfacht.
Das erste Antibiotikum hat Alexander Fleming im Jahr 1929 durch Zufall entdeckt, als er herausfand, wie Penicillin gegen Bakterien wirkt. Fleming hat das Penicillin nie patentieren lassen, sondern es den Medizinern und der Gesellschaft frei zugänglich gemacht. Hierfür erhielt er im Jahr 1945 den Nobelpreis für Medizin. Überraschender Weise ist der am stärksten wachsende Markt für Antibiotika heutzutage nicht der Schutz der menschlichen Gesundheit. Schätzungsweise 50-70 Prozent der Antibiotika werden gesunden Tieren verabreicht, um deren Wachstum um 2-3 Prozent zu steigern, und dienen nicht der Behandlung kranker Menschen. Während diese Praxis in der Europäischen Union erst seit kurzem verboten ist, haben einzelne Länder wie Dänemark dieses Verbot schon im Jahr 2000 durchgesetzt. Nach einem Jahrzehnt lassen die Statistiken darauf schließen, dass die bakteriellen Resistenzen gegen Antibiotika rückläufig sind.
Die Anzahl neuer Antibiotika ist extrem gering. Nur fünf der dreizehn größten Pharmafirmen forschen überhaupt nach neuen Antibiotika. Zwischen 2003 und 2007 wurden nur fünf neue Variationen bereits existierender Antibiotika durch die FDA anerkannt, 20 Jahre zuvor waren es noch 16. Das Problem liegt darin, dass Antibiotika zur Heilung eines Patienten nur 1-2 Wochen verabreicht werden, während ein Krebs- oder Diabetespatient seine Medikamente oft lebenslang benötigt und der Absatz auf dem Markt somit besser gesichert ist. Gleichzeitig sind bestimmte Mutationen von E.coli völlig unempfindlich gegenüber fast allen modernen Antibiotika geworden. Inzwischen stecken sich jährlich etwa 100.000 Amerikaner in Krankenhäusern an.
Der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), eine mutierte Bakterienart, verursacht inzwischen mehr Todesfälle bei Amerikanern als AIDS. Hier wird deutlich, dass die Technologie und der Markt versagt haben. Sobald ein Patent auf ein Antibiotikum verfällt, wird es als Generikum zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises weiterverkauft, was zu verstärktem Konsum führt und somit zu weiteren Mutationen und Resistenzen. Gleichzeitig führt der Verfall des Patents zu einem Umsatzeinbruch; durch die geringeren Einnahmen entfallen Forschung und Entwicklung des Produkts. Letztendlich wird die Entwicklung der Resistenzen auf das betreffende Antibiotikum weder durch den Erfinder, den früheren Halter des Patents, noch durch den Hersteller des Generikums erfasst.
Die Wissenschaft warnt davor, dass schon bald alltägliche Infektionen zur Todesursache werden. Obwohl es sehr kostspielig erscheint, Medikamente mit einer Milliarde Dollar pro Wirkstoff zu subventionieren und den Patienten die Versorgung zu garantieren, denken viele darüber nach, wie die Lücke zwischen der Dringlichkeit neuer Antibiotika für die Gesellschaft und den geringen Einnahmen – trotz massiver Subventionen – für die Pharmakonzerne zu schließen sei. Experten drängen darauf, dass zur Gewährleistung der Wirksamkeit bestehender Medikamente der übermäßige Einsatz in der Medizin und der Tierhaltung gesetzlich geregelt und gleichzeitig der Infektionsschutz in Krankenhäusern verstärkt werden soll. Innovative Ideen hingegen folgen der Logik, dass Antibiotika wie die Artenvielfalt funktionieren; sie sind eine natürliche Ressource, die bewahrt und mit größter Vorsicht genutzt werden sollten.
James Colthurst ist ein britischer Chirurg und Urenkel von Sir Almroth Wright, dem Entdecker des Impfstoffs gegen Typhus, der im selben Labor wie Alexander Fleming arbeitete. Seit seine Schwester schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, erforschte er die Wirkung der Elektrizität auf den Körper. Da seine Expertise auf diesem Gebiet bekannt war, kam eine Gruppe sowjetischer Wissenschaftler auf ihn zu, die die elektrische Stimulation als futuristische Methode der Gesundheitsversorgung auf Weltraumreisen erforschte. Er arbeitete an der Weiterentwicklung dieser Geräte für einen breiteren Wirkungsgrad mit. Nach der Perestroika beschlossen sie, ihre Ergebnisse zu vermarkten, doch Dr. Colthurst zog es vor, seine eigenen Ideen zum Elektro-Biofeedback weiterzuentwickeln. Auf Grundlage seiner Arbeit während seines Bachelorstudiengangs im Jahr 1978 zur Neuro-Anatomie am St. Thomas Hospital stellte er die Fenzian-Hypothese auf.
Diese Hypothese basiert auf der Tatsache, dass die Nerven aus der selben embryonalen Schicht wie die Haut entstehen – dem Neuroektoderm. Ein Netzwerk aus Nerven, bestehend aus dem Zentralnervensystem (ZNS) aus Hirn und Rückenmark sowie dem Periphernervensystem (PNS) sammelt Informationen, wertet sie aus und sendet Signale durch den Körper in Form von elektrischen Impulsen. Diese Impulse werden in chemische Botenstoffe umgewandelt, die die Zellaktivität steuern. Die elektrische Stimulation durch ein simples Gerät, das allen Anforderungen der EU und der FDA in den Vereinigten Staaten entspricht, verhält sich gleichartig wie die Impulse durch Nerven und bilden einen Prozess der biologischen Rückmeldung über einfachen Hautkontakt im Dialog mit dem ZNS. Schon bald konnten Dr. Colthurst und sein Team Beweise in Krankengeschichten finden, von der Asthmabehandlung über Wundheilung, Heilung der Fazialislähmung (Lähmung der Gesichtsmuskulatur) bis hin zur Behandlung von Morbus Crohn und Lupus erythematodes. Da hier Medikamente und Chirurgie durch keine Medikation bzw. keine Operation ersetzt werden konnte, findet sich hier ein Kernmerkmal der Blue Economy: „Ersetze etwas durch nichts“.
Auf eine rückblickende Umfrage unter 600 Patienten hin, die in der Zeitschrift Pain Clinic erschien (The Pain Clinic 2007 Band 19 Nr. 1) wurde 2009 eine erste Pilotstudie zur Behandlung durch elektrische Stimulation bei Asthma auf Grundlage der Fenzian-Hypothese als Brief im European Respiratory Journal veröffentlicht (Band 34, Nr. 2, S. 515-517). Hier wurde eine neuartige alternative Behandlung ohne Einsatz von Medikamenten bewiesen. Zwar ist sich die Wissenschaft einig, dass der genaue Mechanismus noch unbekannt ist, doch für sie steht fest, dass diese Art von „Biofeedback“ über das Zentralnervensystem Veränderungen bewirken kann. Dies führte zu klinischen Versuchen in sechs medizinischen Einrichtungen, darunter an der University of California, Los Angeles, am Johns Hopkins Hospital und an der Universität Kapstadt.
Gleichzeitig wurden Fonds für weiterführende Studien am Manchester Interdisciplinary Biocentre bereitgestellt. Die wissenschaftliche Wundenforschung in Manchester liefert extrem positive Resultate. Nun ist eine Reihe von Studien in vitro notwendig, um den wissenschaftlichen Vorstoß weiter zu untermauern. Währenddessen gründete Dr. Colthurst die Firma Fenzian Limited als im Vereinigten Königreich registriertes privates medizinisches Zentrum für Forschung und Entwicklung mit Unterstützung von europäischen und amerikanischen Investoren, die verschiedene, mehr oder weniger positive Erfahrungen mit der Fenzian-Hypothese im Bereich von Medizin und Gesundheitsversorgung sammeln konnten.
Die Regierungen stehen vor vielerlei Herausforderungen. Zum einen verursacht die alternde Gesellschaft immer höhere Kosten in der Gesundheitsversorgung. Zum anderen stehen sie vor immer größeren Haushaltsdefiziten, die die Genehmigung Milliardensubventionierungen durch die entsprechenden Behörden zunehmend erschweren. Die Pharmakonzerne hingegen müssen immer mehr Auflagen bei der Zulassung neuer Medikamente erfüllen, die Kosten für Rechtsstreitigkeiten steigen, viele Patente für Arzneien stehen kurz vor ihrem Ablaufdatum, und das Problem der Medikamentenfälschung nimmt zu, während gleichzeitig Chirurgie und längere Krankenhausaufenthalte das Infektionsrisiko der Patienten erhöhen.
Das weite Spektrum möglicher Anwendungen von Dr. Colthurst’s neuartigem Ansatz durch die Fenzian-Technologie jedoch öffnet neue Perspektiven, die die Pharmakonzerne von ihrem beschränkten Fokus auf chemische Mittel mit wenig Einnahmen erlösen können. Fenzian macht Subventionen unnötig, reduziert Kosten, die durch Nebenwirkungen entstehen und arbeitet mit der Fähigkeit zur Selbstheilung des Körpers stimulieren. Nutze, was du hast – das ist eins der Kernprinzipien der Blue Economy.
Bilder: Stock.XCHNG