Blue Economy: Paradigma für eine nachhaltige Zukunft
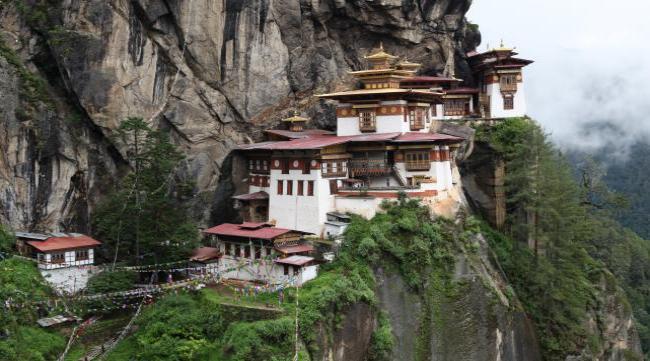
Heutzutage leben wir auf eine Weise, die unser Planet nur begrenzte Zeit tragen kann. Doch mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung kann nicht einmal ihre Grundbedürfnisse stillen und muss ein Recht auf Wachstum haben. Die Zukunft unserer Gesellschaft und Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft sind nur vorstellbar, wenn wir lernen, mehr Wohlstand für eine wachsende Zahl von Menschen zu schaffen und dabei weniger natürliche Ressourcen zu verbrauchen. Seit inzwischen zwanzig Jahren wächst die Erkenntnis, dass die größte physische Bedrohung für das ökologische Bestehen die riesige und unnötige Verschwendung natürlicher Ressourcen ist. Um 1 kg technologisches Gerät herzustellen, werden etwa 30 kg natürliche Rohstoffe verbraucht, Wasser nicht eingeschlossen. Ohne diese Technologie können moderne Dienstleistungen nicht geliefert werden. Über 90% der denaturisierten Umwelt, die zur Schaffung materiellen Reichtums verbraucht werden, tragen nicht zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse und Träume bei.
Wenn im Juni dieses Jahres die Regierungs- und Staatschefs in Brasilien zusammentreffen, um über eine nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene zu diskutieren, wird auch die Frage nach einer nachhaltigen Wirtschaft aufkommen. Es hat lange gebraucht, bis die Regierungen sich über grundlegende Richtlinien des Begriffs der „Grünen Wirtschaft“ einig wurden. Über ein Jahrzehnt lang wurde die „Grüne Bewegung“ ohne einheitliche politische Idee geformt, was zum gegenwärtigen vielschichtigen Begriff der „Green Economy“ geführt hat. Einige nennen es auch lieber „Greenwashing“ oder „Grünfärbung“. Langsam ergab sich der politische Konsens, Ziel der Grünen Wirtschaft sei eine „für die Natur tragbare Wirtschaft mit niedrigen Emissionen“. Selbstverständlich ist ein grundlegendes Regelwerk nötig, um diesen Weg zu verfolgen, das innovationsorientierte Unternehmen unterstützt und die Emission von Schadstoffen in die Umwelt reduziert. Trotz allen Fortschritts, der auf diesem Gebiet erreicht wurde, wissen wir, dass die Grüne Wirtschaft nur ein Schritt der Transformation auf dem Weg zu einem Paradigmenwechsel in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ist.
Dieses neue Paradigma nennen wir Blue Economy. Nachhaltiges Wirtschaften im Sinne der Blue Economy ermöglicht es, die Grundbedürfnisse aller ohne Ausbeutung der natürlichen Ressourcen , aber auch ohne Verzicht auf materielle Güter zu erfüllen. Im Gegensatz zur Green Economy steht die Blue Economy für eine neue Weise der Unternehmensgestaltung, ein neues marktorientiertes Geschäftsmodell, nachhaltige Unternehmen und nachhaltiges Wachstum. Blue Economy steht dafür, das Gute erschwinglicher und das Schlechte teurer zu machen. Blue Economy steht für sauberes Wasser, saubere Luft und für den Planeten Erde.
Der Begriff Blue Economy bedeutet: Durch Nutzung vorhandener Ressourcen in Kaskadensystemen werden die Abfälle eines Produkts zum Rohstoff für einen neuen Cashflow. Auf diese Weise entstehen Arbeitsplätze, es wird gesellschaftliches Kapital aufgebaut und das Einkommen steigt – ohne weitere Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt, sondern eher durch ihre Schonung und Verbesserung. So wird nachhaltiges Wachstum möglich. Durch Innovationen und Unternehmertum kann das gegenwärtige Weltwirtschaftssystem in eine nachhaltige Entwicklung geführt werden. Innovationen und bessere Lebensumstände werden durch Nachfrage, die Mittel des Freien Markts und Bildung gestärkt, anstatt sie durch Subventionen und soziale Barrieren zu behindern.
Der Schlüssel hierzu ist eine ganzheitliche Sicht der Dinge, es geht um intelligente Synergien und Verknüpfungen auf verschiedenen Ebenen (Kaskaden) innerhalb von (Öko)systemen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind. Die 1995 durch Gunter Pauli in Vorbereitung auf die Kyoto-Protokolle gegründete ZERI-Stiftung hat über viele Jahre Beispiele solcher neuer Geschäftsmodelle aufgespürt und aufgezeigt und sie unter dem Begriff „Blue Economy“ beworben. Jetzt müssen wir den Dialog suchen, um ein ganzheitliches Verständnis einer in Wechselbeziehungen stehenden Produktionswelt zu fördern und die Grundressource Wasser mit einbeziehen, die essentiell für das Leben von Pflanzen, Tieren, Algen und Bakterien ist.
Wachstum und der Wert der Natur
Die ökologische Währung zur Schaffung nachhaltigen Wohlstands ist die maximal erreichbare Ressourcenproduktivität. Materielles Wachstum ist das Gegenteil. Heutzutage kann jeder der Natur Ressourcen entziehen und sie zur eigenen Bereicherung einsetzen, ohne dafür einen angemessenen Preis zu zahlen. Heutzutage verbrauchen Menschen enorme Mengen an Energie, um jährlich über 100 Milliarden Tonnen Material zu bewegen, Wasser und umgepflügtes Land nicht eingerechnet. Dies ist mehr als das Doppelte dessen, was die Natur erreichen kann. Daher kann die Menge der für den Wohlstand eingesetzten Ressourcen als Messgröße für den potentiellen Umweltschaden aller Güter und Leistungen dienen – der so genannte ökologische Fußabdruck. Im ökologischen Sinne hoffen wir, die Prozesse zu beschleunigen, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen verringern.
Dies könnten wir recht schnell erreichen, ohne Komfort oder Wohlstand einzubüßen. Bereits 2004 veröffentlichten Ökonomen, dass die kleinen und mittelständischen Betriebe in Deutschland 20% ihrer Kosten für Ressourcen einsparen könnten, ohne dass die Qualität des Endprodukts darunter litte, d.h. über 150 Milliarden Euro pro Jahr. Mit anderen Worten: die Einsparung natürlicher Ressourcen zahlt sich aus, doch die wenigsten Firmen haben die Vorteile der Steigerung der Ressourceneffizienz erkannt. Es scheint, die Politik muss (über einen begrenzten Zeitraum) Anreize schaffen. Es ist wissenschaftlich unmöglich, die ökologisch giftigen Folgen der Wirtschaft in allen nötigen Einzelheiten zu messen, genaue Voraussagen zu treffen oder solche Messungen für die Umweltpolitik heranzuziehen. Wie bei allen Indikatoren können Ressourcenproduktivität und –intensität nur annähernd die mögliche Umweltbelastung aufzeigen. Somit sind Verbote wenig sinnvoll.
Stattdessen muss der Preis für die Extraktion und Nutzung der Natur an die Realkosten angepasst werden. Eine Möglichkeit wäre, die Finanzlast von der Arbeitskraft auf die natürlichen Ressourcen zu verschieben (makroökonomisch kostenneutral). Dies scheint angemessen, da das natürliche Kapital im Gegensatz zur Arbeitskraft immer knapper wird. Nur wenn für die in den wirtschaftlichen Metabolismus einfließenden Rohstoffe der volle Kostenpreis berechnet wird, werden Innovationen, die die Ressourceneffizienz erhöhen, erfolgreicher. Das einzige Umweltsiegel, das weiterhin erforderlich wäre, bezöge sich dann auf die Giftigkeit von Produkten.
Neue Geschäftsmodelle
Wir müssen mehr tun als nur Energie einsparen: Wir müssen die Effizienz erhöhen. Ebenso wichtig ist die Effektivität, das Auffinden der bestmöglichen Ressourcennutzung; so schöpfen wir viel mehr Wert aus den verfügbaren Ressourcen. Das gegenwärtige Geschäftsmodell konzentriert sich auf materielles Wachstum, Massenproduktion, Kerngeschäft und Kernkompetenz und begünstigt die Spezialisierung und Konzentration auf ausgewählte Märkte. Der Erfolg eines Unternehmens misst sich durch Geld und Marktanteile und nicht an der Fähigkeit, nachhaltigen, langfristigen Nutzen für die Verbraucher zu schaffen.
Es scheint, wir brauchen dringend ein neuartiges Geschäftsmodell, um eine zukunftsträchtige Wirtschaft zu unterstützen. Eine zentrale Voraussetzung ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller, d.h. Nahrung, Leistungen und Ressourcen so lokal und selbstverantwortlich wie möglich – nur dann kann Glück erreicht werden. Hier ein Beispiel, wie Wertschöpfung hundertfach durch moderne Gewohnheiten erhöht werden kann:
Von der Kaffeebeere bis zur fertigen Tasse Kaffee werden nur 0,2% der Pflanze wirklich genutzt. Mit anderen Worten, es müssen 99,8% entsorgt werden, dies entspricht 7,5 Millionen Tonnen Kaffeesatz, die bestenfalls verbrannt oder kompostiert werden oder eben auf Müllhalden landen. Stattdessen könnte das Hartholz zur Edelpilzzucht verwendet werden; nach der Ernte bekommen Würmer die Reste, daraus wiederum wird Fischfutter und hochwertiger Dünger. Es bleibt kein Abfall zurück, stattdessen erhalten wir drei neue Produkte und schaffen somit Cashflows und Arbeitsplätze. Dieses Modell nutzen bereits Firmen in Berlin, San Francisco, Mexiko-Stadt und Madrid. Die Kaffeekonzerne hingegen machen überhaupt keinen Gebrauch von dieser Effizienz, den Ressourcen und dem Gewinnpotenzial. Stattdessen geben sie Geld für teures „Greenwashing“ aus.
Die als „Blue Economy“ veröffentlichten Geschäftsmodelle zeigen, dass die Natur der effizienteste UND effektivste Wirtschaftsagent unseres Planeten ist. Alle Probleme besitzen mehrerlei Lösungen, die weder Abfälle noch unbeabsichtigten Kollateralschaden verursachen. Viele hochgiftige Komponenten unserer Produkte, die einen großen materiellen Fußabdruck durch ihre Produktionsweise verursachen, könnten einfach durch „nichts“ ersetzt werden – so zum Beispiel können Batterien durch natürliche Elektrizität aus Temperaturunterschieden ersetzt werden. Wenn wir die Produktentwicklung an natürlichen physikalischen Prinzipien orientieren, öffnen wir die Türen zu ungeahntem Potenzial, zum Beispiel bei der Wasserreinigung durch Nutzung der Schwerkraft als einziger Energiequelle (wodurch Chlor und teure Filter überflüssig werden).
Das Ergebnis sind billigere und bessere Produkte – besser für uns alle einschließlich der Natur. Wir hoffen, dass die Politik, das Unternehmertum und die Verbraucher verstehen werden, dass es möglich ist, schon heute eine nachhaltige „Zukunft“ zu leben. Alles was wir brauchen, ist eine Änderung der Sichtweise und nicht den Verzicht auf Reichtum oder Erfüllung von Bedürfnissen.
Eine Politik des lokalen Wachstums und der Hinlänglichkeit
Um das heute bereits mögliche und bekannte Potenzial zu erkennen, muss die Politik sie in Szene setzten. Ein durchdachtes Programm für Innovation und Wertschöpfung zur Ressourceneffektivität sollte folgendes beinhalten:
- Vorsorgend frühzeitige Durchsetzung systemgerechter Lösungen [EU 6.1]
- Gezielte Verbesserung der Ressourcenproduktivität [EU 1., 6.1]
- Durchsetzung von Realpreisen auf dem Markt („full-cost-pricing“) [EU 3.4.2]
-Effektive Verantwortung von Politik und Unternehmern für Kollateralschäden (Homburg)
- Vereinbarung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ziele für eine stabile Zukunft [EU 6.1]
- Definition von Umweltindikatoren auf allen politischen Gebieten [EU 1., 2.6.1
- Abschaffung verbrauchsfördernder Subventionen [EU 3.4.1]
- Begrenzung der kurzfristigen Gewinnmaximierung
- Vermeidung von „toxischen Produkten“ (Stiglitz), [EU 3.1.2]
- Aufbau von Frühwarnsystemen
-Festsetzung verlässlicher Standards für Accounting, Berichte und Kennzeichnung [EU 4.1]
Wir hoffen, dass Rio+20 einige bedeutende Schritte in diese Richtung erreicht, da die Zeit knapp wird. Eine Studie der deutschen Bundeswehr schloss im Juli 2010, „dass das sehr ernst zu nehmende Risiko besteht, dass eine durch nachhaltige Knappheit von wichtigen Rohstoffen ausgelöste globale Transformationsphase von Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen nicht ohne sicherheitspolitische Friktionen vonstatten gehen wird. Die Desintegration komplexer Wirtschaftssysteme […] hat direkte, teilweise schwerwiegende Auswirkungen auf viele Lebensbereiche, auch und insbesondere in Industrieländern. […]Der mit diesen verbundene Paradigmenwechsel […] widerspricht ökonomischer Logik und kann deswegen nur in begrenztem Umfang Marktkräften überlassen werden.“
Ohne ökosystemische Leistungen und Funktionen, aus denen die Menschen sich einmal entwickelt haben, kann die Menschheit auf der Erde nicht überleben. Wir alle müssen sofort handeln, um unser Recht auf eine Zukunft zu schützen, aber auch die Rechte der Zukunft: Ein Recht auf glückliches Leben und Wohlstand in Harmonie mit der Natur.
ZERI Germany e.V. (Zero Emissions Research & Initiatives)
Markus Haastert, Vorstand
Blue Economy Institute
Anne-Kathrin Kuhlemann, Vorsitzende
Um diesen Bericht als pdf herunterzuladen, klicken Sie bitte hier.



